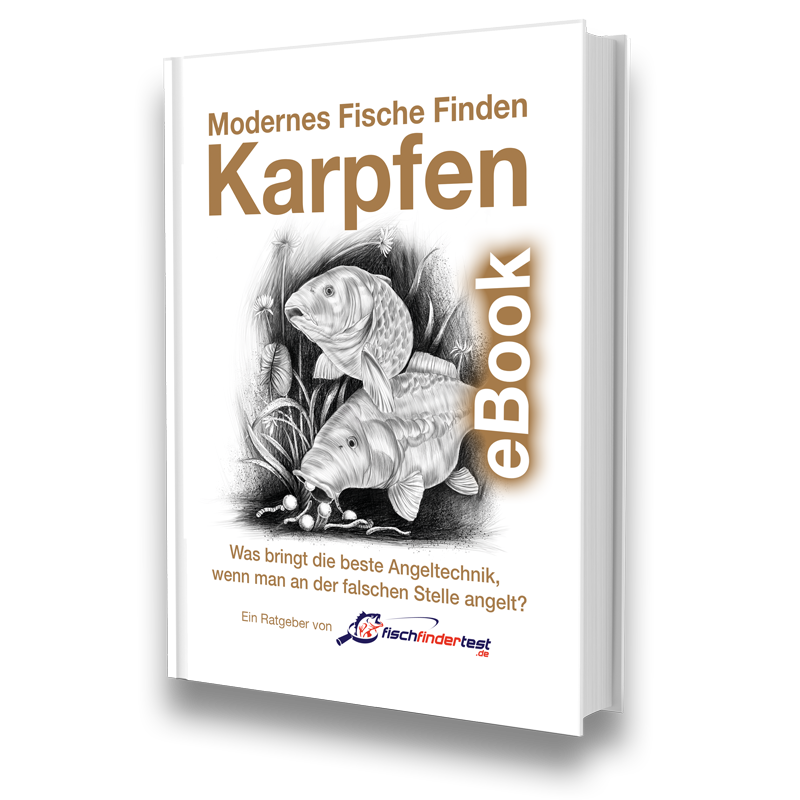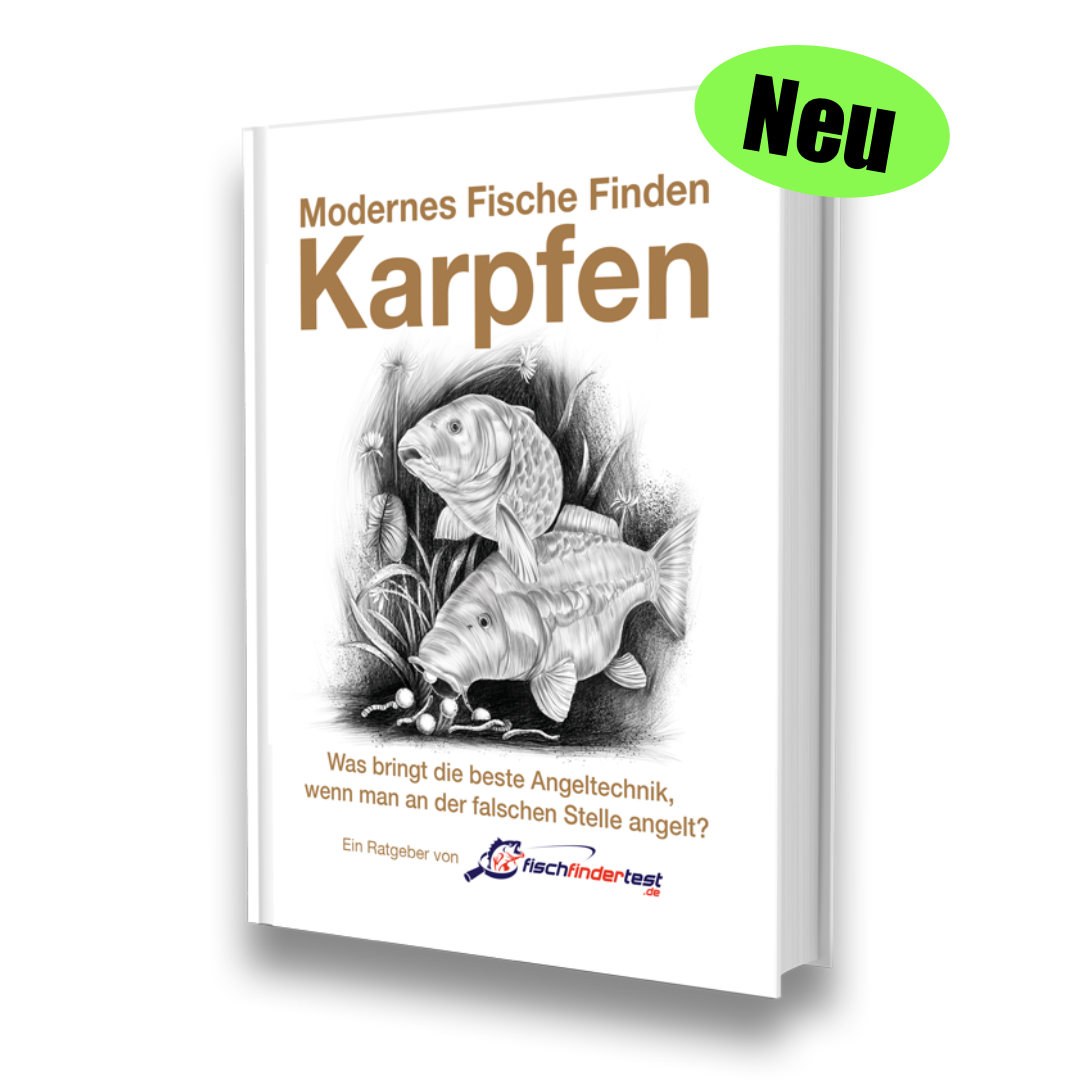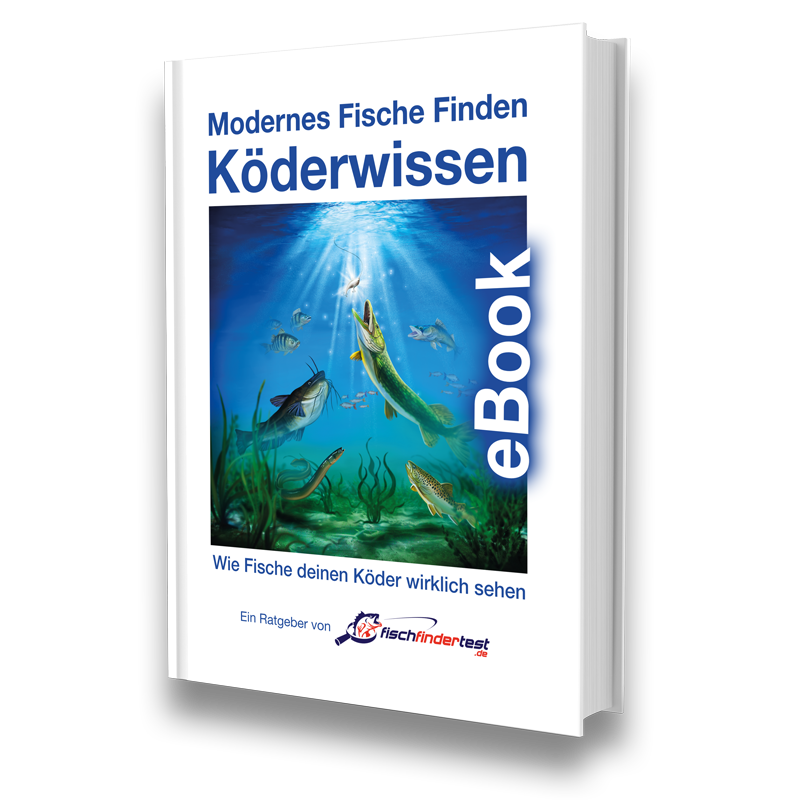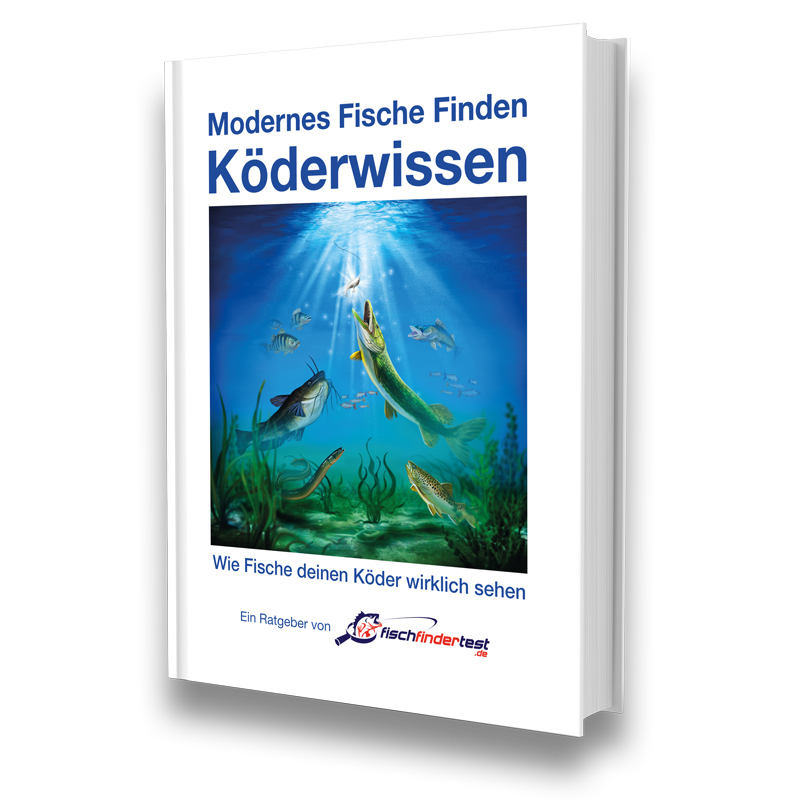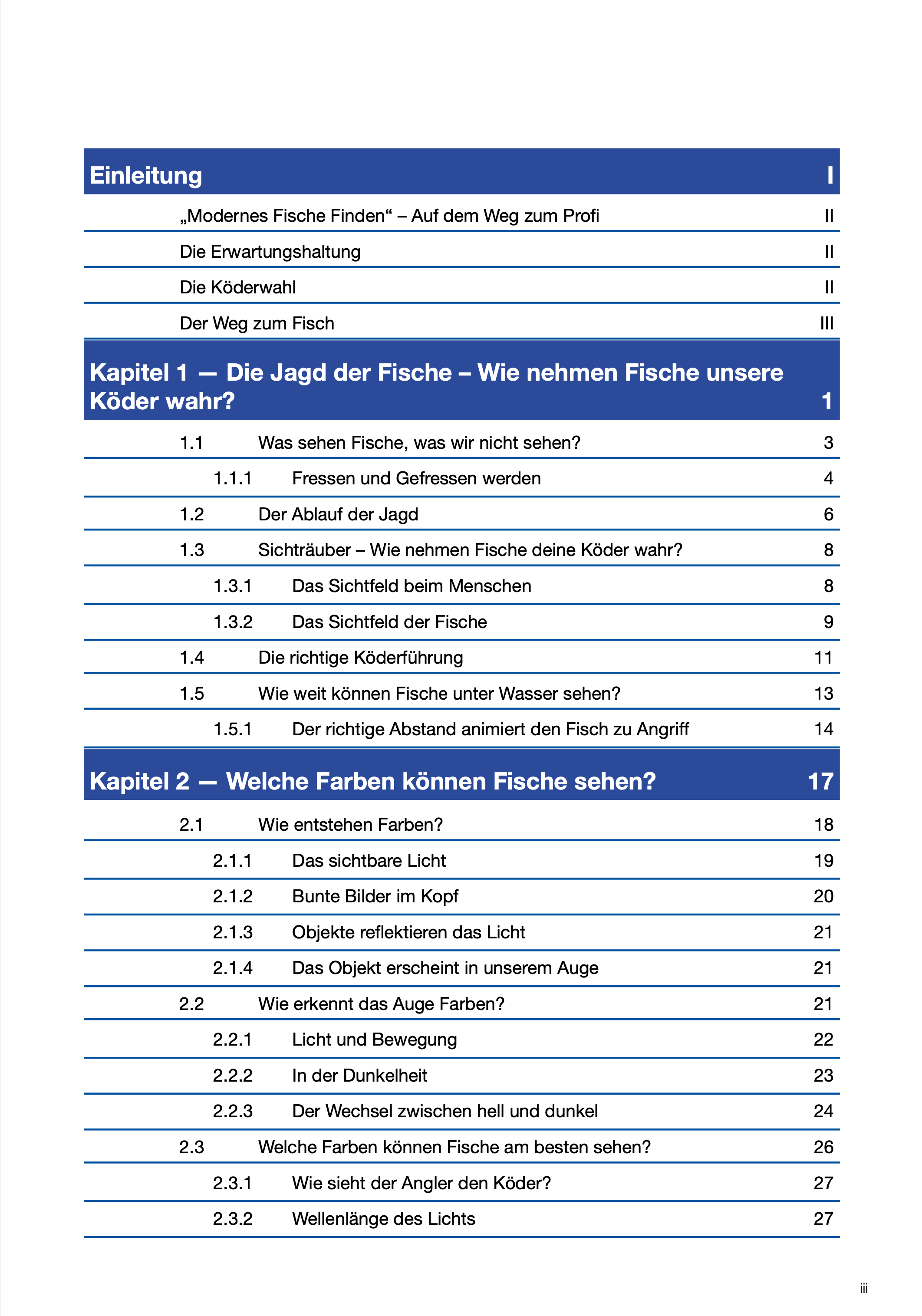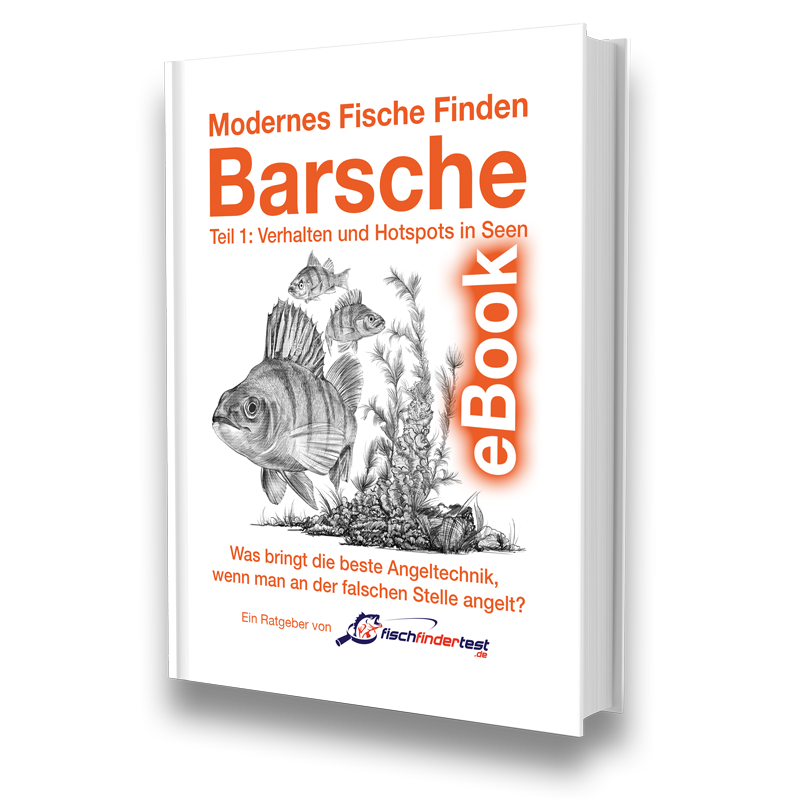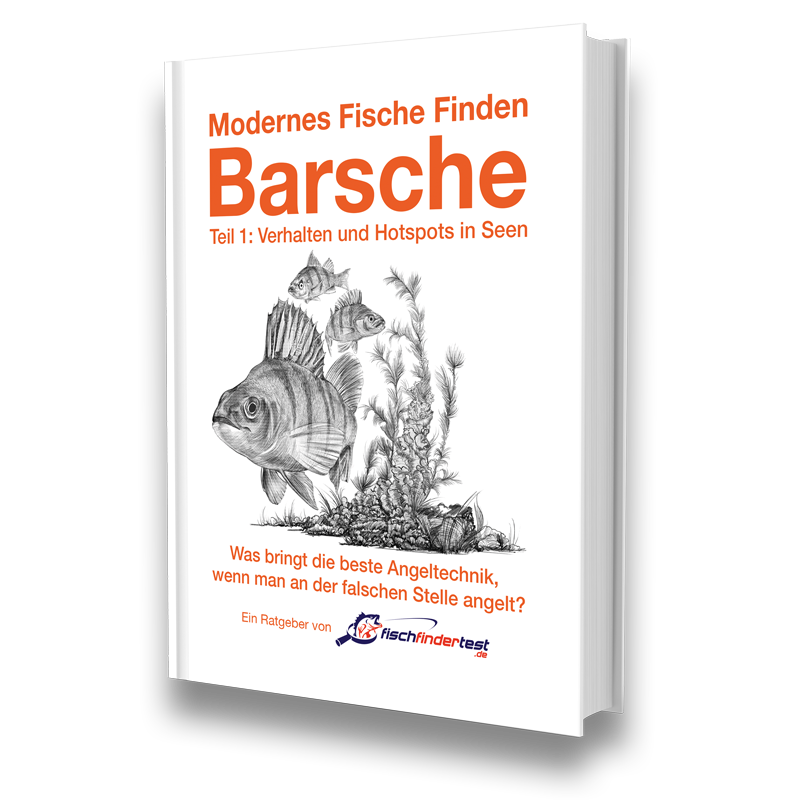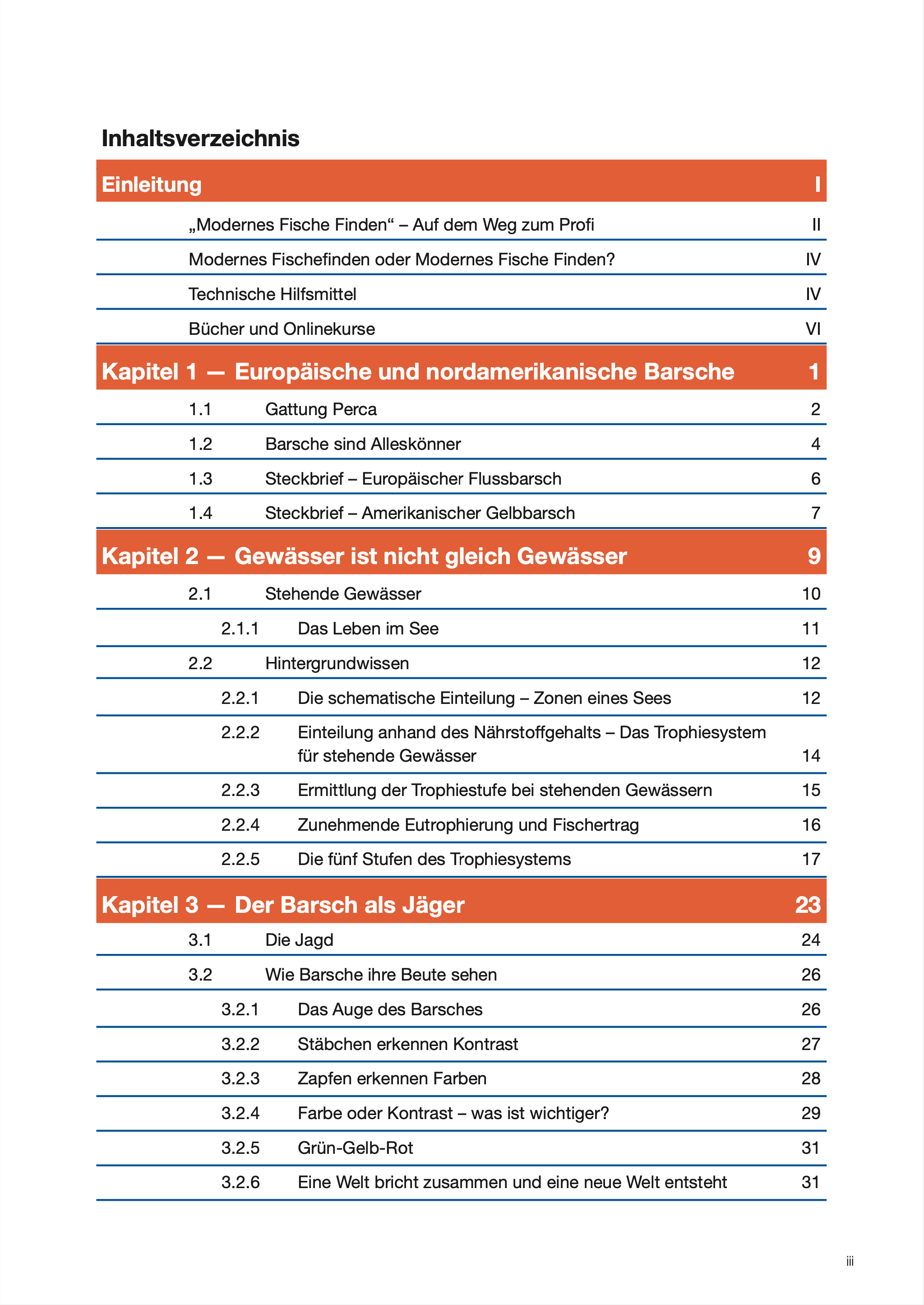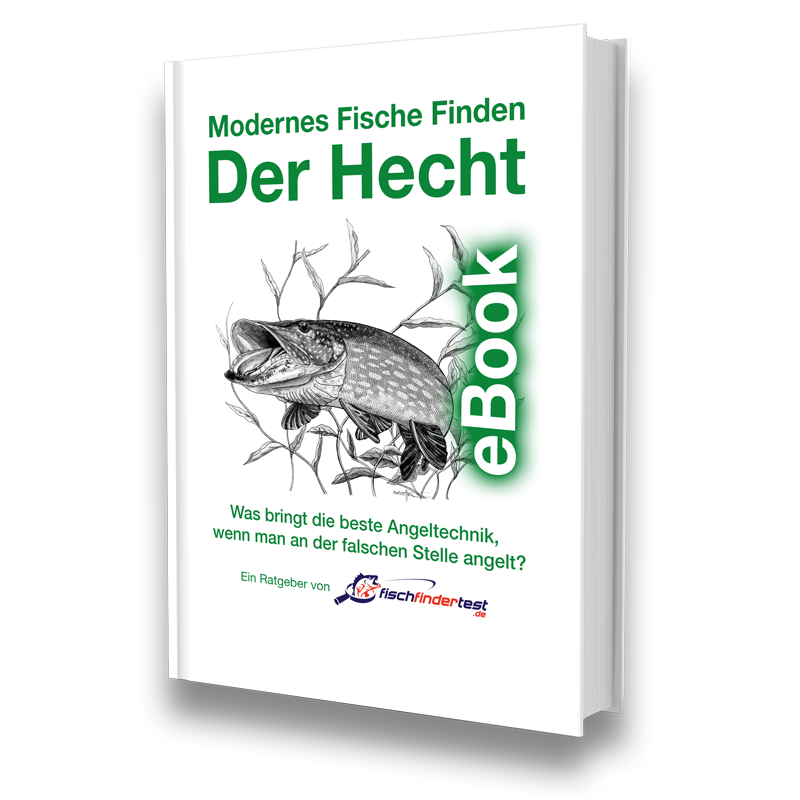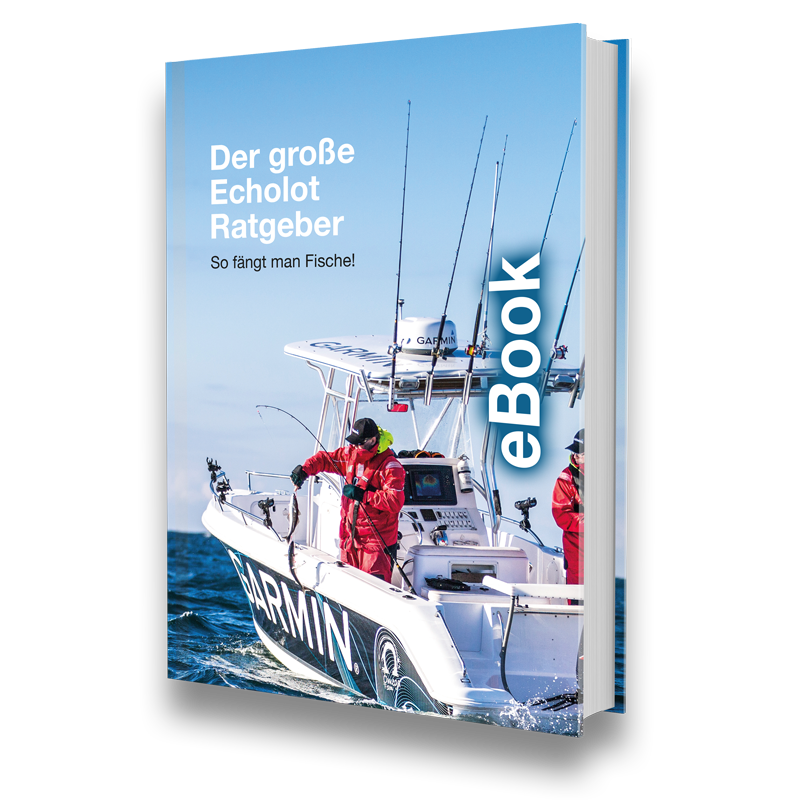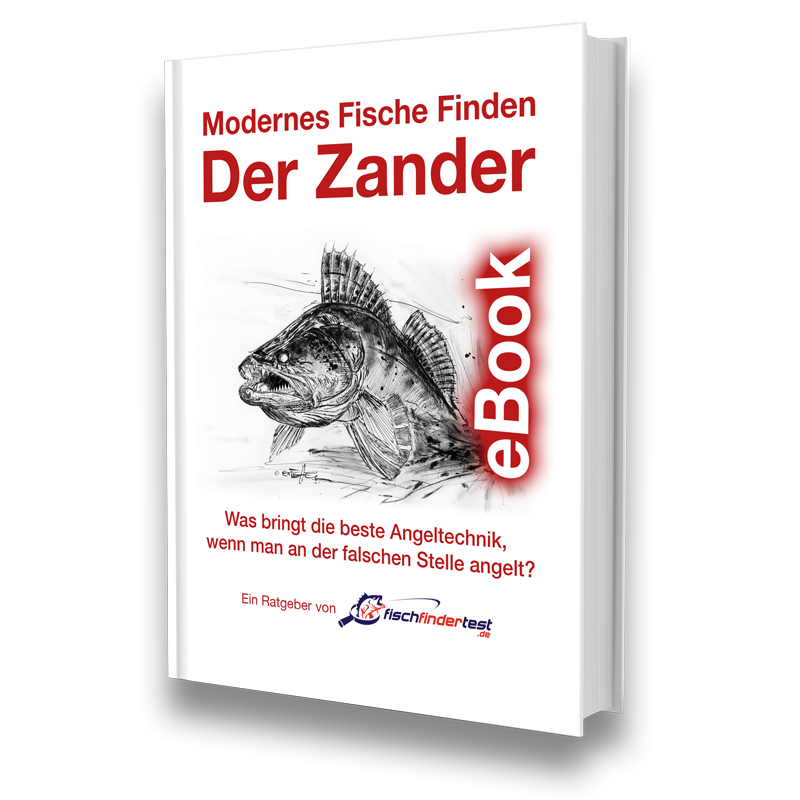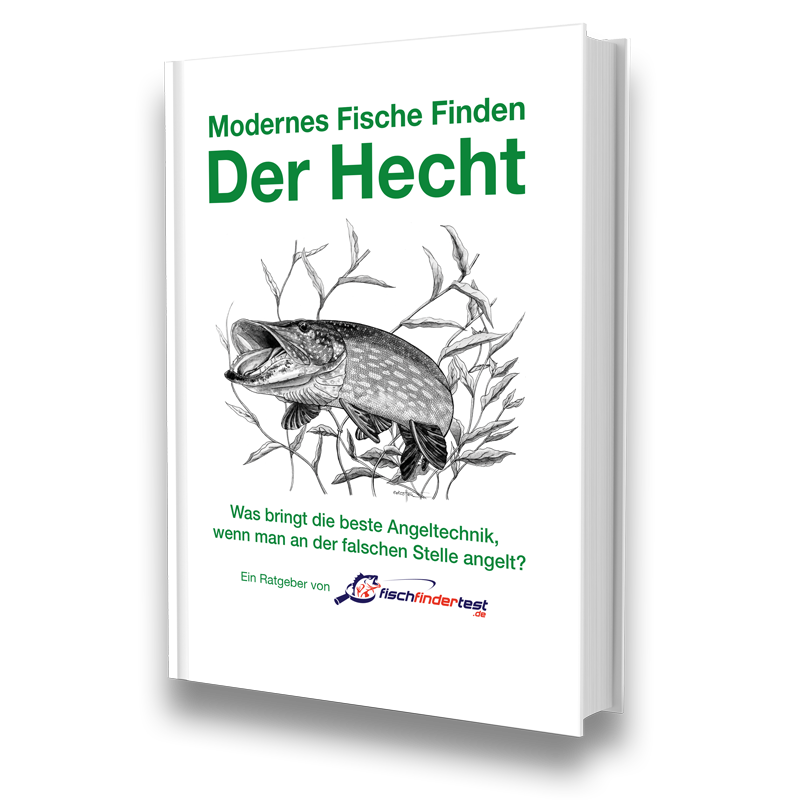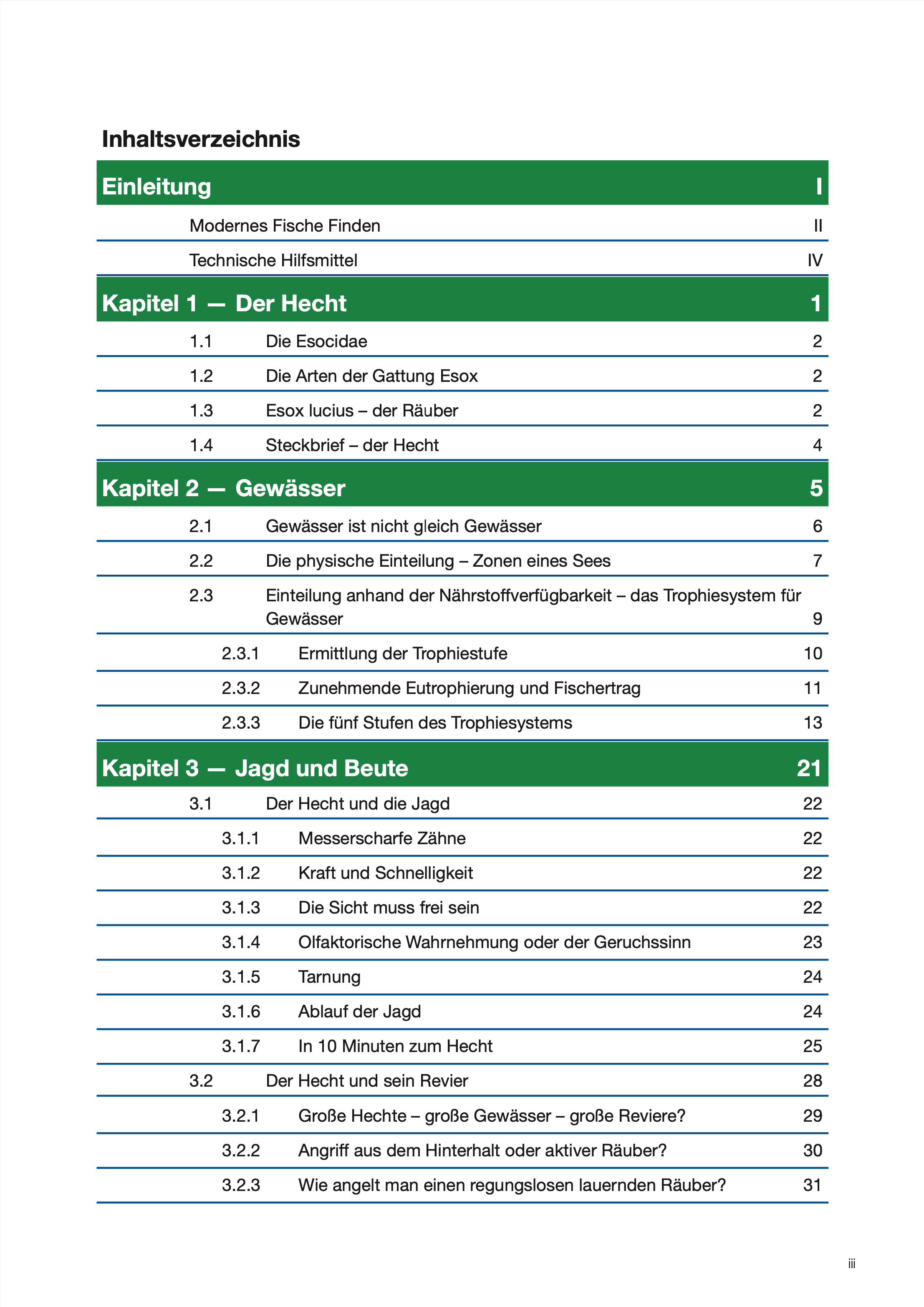Menu
Close
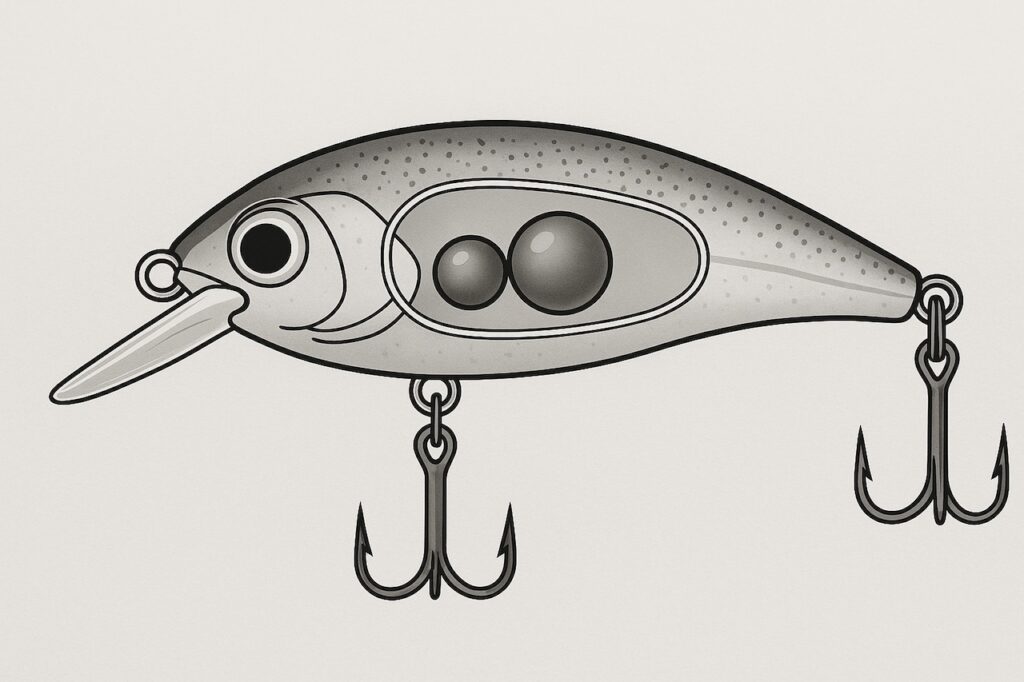
4.4
(43)
Viele Angler schwören darauf: Kunstköder mit Rasseln, die unter Wasser laut klackern, sollen mehr Bisse bringen. Aber können Fische diese Geräusche überhaupt hören? Insbesondere unsere heimischen Süßwasserfische – Barsch, Zander, Hecht, Wels (Waller) und Karpfen – haben ein sehr unterschiedliches Höhrvermögen. In diesem Beitrag nehmen wir das Köderrassel einmal wissenschaftlich unter die Lupe und liefern erhellende Fakten: Welche Geräusche oder besser Frequenzen hören Fische? Liegt das Rassel-Geräusch im hörbaren Bereich oder nur in unserem Einbildungsraum? Schon im ersten Drittel gibt es klare Antworten, weiter unten folgen die wissenschaftlichen Belege und Studien dazu.
Können Fische das Rasseln von Kunstködern hören?
Kurze Antwort: Ja und Nein.
Aber fangen wir doch tuerst bei uns Menschen an.
Wir Angler schütteln einen Wobbler am Ufer oder im Laden und hören sofort das laute Klackern der eingebauten Rasselkugeln. Für uns Menschen klingt das eindringlich, schließlich nehmen wir Töne im Bereich von etwa 20 bis 20.000 Hertz wahr. Doch Fische haben ein ganz anderes Hörvermögen: Die meisten heimischen Süßwasserarten reagieren nur auf einen Bruchteil dieses Spektrums – oft lediglich 30 bis 1000 Hertz. Alles, was darüber liegt, bleibt für sie still.
Das bedeutet: Was wir beim Köderkauf klar hören, ist für viele Fische schlicht unhörbar. Der Rasselton selbst erreicht ihre Sinnesorgane kaum. Anlockend wirkt in erster Linie die Bewegung des Köders, weil sie Druckwellen im Wasser erzeugt – und die nehmen Fische sehr zuverlässig wahr.
Viele Raubfische hören nur tiefe Töne – deutlich tiefer als das schrille Klappern mancher Kunstköder-Rasseln. Tatsächlich liegen die lautesten Geräusche von Rassel-Wobblern meist bei über 2.000 Hz und damit außerhalb des Hörbereichs der meisten Süßwasser-Räuber.
Hechte, Barsche und Zander – als typische Raubfische – reagieren vor allem auf tieffrequente Schwingungen um 50–300 Hz und hören Töne über ~600–1000 Hz kaum noch. Dennoch können Rasselköder Fische anlocken: Jeder bewegte Köder erzeugt Druckwellen im Wasser, die über das Innenohr oder das Seitenlinienorgan wahrnehmbar sind.
Bei Wels (Waller) und Karpfen sieht die Sache schon anders aus. Sie besitzen ein feineres Gehör als die meisten andere Fischarten und nehmen auch mittlere Frequenzen bis in den Kilohertz-Bereich wahr.
Hörspezialisten vs. Hörgeneralisten
Ob ein Fisch nur tiefe Töne hört oder auch höhere, hängt an seiner Biologie. Nicht alle Fische hören gleich gut oder gleich weit in den Frequenzbereich hinein. Die meisten unserer heimischen Arten sind auf niedrige Tonlagen spezialisiert. Dr. Arthur Popper, ein führender Fisch-Akustik-Forscher, fasst es so zusammen: “Die meisten Fische, in Süß- und Salzwasser, nehmen Schall von etwa 40 Hz bis 500 oder 1000 Hz wahr”. Zum Vergleich: Ein jugendlicher Mensch hört etwa 20 Hz bis 20.000 Hz.
Einige Ausnahmen unter den Fischen kommen in höhere Bereiche, z.B. Heringe über 3000 Hz oder Shads (Heringsartige) sogar bis ins Ultraschallgebiet von ~200.000 Hz – vermutlich um jagende Delfine zu belauschen und zu entkommen. Solche Fälle sind aber rar. Im Allgemeinen liegt die obere Hörgrenze der Fische bei ungefähr 1.000–1.500 Hz (1–1.5 kHz). Töne darüber werden – wenn überhaupt – nur von wenigen speziellen Arten wahrgenommen.
Wie nehmen Fische Schall überhaupt wahr?
Fische besitzen keine sichtbaren Ohren wie wir. Sie haben stattdessen ein Innenohr mit Sinneszellen und sogenannten Otolithen (Ohrsteinchen). Bei einigen Arten – etwa Karpfen, Schleie, Barben und Wels – verbindet ein kleiner Knochenapparat (der Weber’sche Apparat) die Schwimmblase mit dem Innenohr. Sie sind Hörspezialisten. Dadurch werden Schwingungen besonders effizient übertragen. Diese Arten gelten als „Hörspezialisten“ und können auch höhere Frequenzen bis über 1000 Hz wahrnehmen.
Fische ohne speziellen Schwimmblasen-Knochen-Anschluss sind “Hörgeneralisten”. Dazu zählen viele Raubfische wie Hechte, Barsche, Zander, Lachse/Forellen und Barschartige generell. Ihnen fehlt die direkte Kopplung der Schwimmblase ans Innenohr – oft ist die Schwimmblase auch kleiner oder fehlt (bei manchen Bodenfischen). Sie können zwar ebenfalls hören, aber nur im tieffrequenten Bereich und mit höherer Reizschwelle. Höhere Geräusche, wie sie Rasseln im Köder erzeugen, bleiben für sie weitgehend bedeutungslos.
Ergänzend zum Innenohr spielt das Seitenlinienorgan eine entscheidende Rolle. Es registriert feine Druckunterschiede und Strömungen – ähnlich wie eine verlängerte Hautsensibilität. So spürt ein Hecht die Bewegung eines Köders oder eines Beutefisches, auch wenn er das Rasseln selbst gar nicht hören kann.
Mensch vs. Fisch – ein Vergleich
Eine klassische Untersuchung mit trainierten Schwarzbarsch (Bsp. für einen Hörgeneralisten) fand maximale Hörsensitivität um 100 Hz. Über 200 Hz reagierten die Fische schon deutlich schwächer, und ab 600 Hz war praktisch keine Reaktion mehr feststellbar. Ähnliches wird für unsere Flussbarsche, Zander und Hechte angenommen – sie hören tiefe Töne gut, mittlere schlecht und hohe gar nicht. So wurde z.B. bei Salmoniden (Forelle, Lachs) eine obere Hörgrenze um ~400 Hz gemessen. “Was wir Angler hören, hören die Fische noch lange nicht”, bringt es ein Biologe auf den Punkt. Nur die untersten ~5–10 % unseres menschlichen Hörspektrums sind für die meisten Raubfische relevant.
Wels und Karpfen: Top-Hörer im Süßwasser. Unsere größten heimischen Süßwasserfische, der Waller (Europäischer Wels) und der Spiegel-/Schuppenkarpfen, gehören beide zur “Hör-Elite” der Fische. Dank Weber’schem Apparat und großer Schwimmblase verfügen sie über bemerkenswert feine Ohren. Prof. Friedrich Ladich, ein renommierter Fisch-Hörforscher, nennt Welse “absolute Top-Fische, was das Hören betrifft”. Sie können sehr leise Geräusche und höhere Frequenzen wahrnehmen im Vergleich zu Hecht & Co. Tatsächlich machen sich Angler dieses Gehör beim Wallerangeln zunutze: Mit dem Wallerholz erzeugt man ploppende Geräusche auf der Wasseroberfläche, die angeblich wie Fressgeräusche von Welsen klingen – neugierige Waller werden aus großer Entfernung angelockt. Dass das funktioniert, zeigt: Welse hören diese dumpfen Klopfgeräusche (die vermutlich im Bereich unter 200 Hz liegen) ausgesprochen gut. Auch Karpfen sind sehr hellhörig im wahrsten Sinne. Erfahrende Karpfenangler wissen, wie wichtig Ruhe am Wasser ist: Schon schwere Schritte oder lautes Reden am Ufer machen vorsichtige Karpfen misstrauisch.
Karpfen und Insekten
Was hören Karpfen genau? Eine Untersuchung ergab, dass Karpfen selbst tiefe Laute erzeugen (sogenannte Trommellaute via Schwimmblase) im Bereich 16–300 Hz. Daher können sie solche Bässe vermutlich auch besonders gut orten. Man geht aber davon aus, dass sie alle Frequenzen von 20 Hz bis 1000 Hz sehr gut wahrnehmen können – also praktisch den gesamten Bereich, in dem unter Wasser natürlich relevante Geräusche auftreten. An wirklich hohe Frequenzen (mehrere kHz) reichen Karpfenohren wohl nicht ganz heran; allerdings gibt es Anzeichen, dass sie zumindest ein Stück über 1 kHz hinaus hören. Beispielsweise zirpen manche Wasserinsekten (Ruderwanzen, Wasserkäfer) in hohen Tonlagen unter Wasser, was für uns wie ein hohes Fiepen klingen würde. Im Frühjahr kann man regelrecht ein Unterwasserkonzert von Insekten wahrnehmen (mit Hydrofonen). Da Karpfen gezielt in flache, insektenreiche Bereiche ziehen, um zu fressen, liegt die Vermutung nahe, dass sie diese hohen Insekten-Geräusche hören und als “Futterruf” erkennen. Absolute Gewissheit gibt es hier noch nicht – es ist schwer, einem Karpfen im Freiwasser einen Hörtest vorzuspielen. Aber die Kombination aus Anatomie und Verhalten spricht dafür, dass Karpfen deutlich mehr hören, als man lange annahm.
Menschliches Gehör: 20 Hz – 20.000 Hz, empfindlich besonders bei Sprache (1.000–4.000 Hz).
Hecht, Zander, Barsch: ca. 30–600 Hz, mit Maximum um 100–200 Hz.
Karpfen: durch Weber’schen Apparat feines Gehör bis ca. 1.000 Hz, vermutlich sogar etwas darüber hinaus. Sie nehmen leise Geräusche am Ufer wahr – jeder Schritt oder ein klappernder Eimer kann sie verschrecken.
- Wels: einer der besten Hörer im Süßwasser. Reagiert empfindlich auf dumpfe Klopfgeräusche (z. B. Wallerholz), hört bis über 1.000 Hz.
Damit wird klar: Das helle Klackern eines Rasselköders, das wir Menschen problemlos bei mehreren Tausend Hertz hören, liegt meist oberhalb des Fisch-Hörbereichs. Was bleibt, sind die tieferen Nebengeräusche des Köders und vor allem die Druckwellen seiner Bewegung.
Was erzeugt ein Rasselköder wirklich?
Kunstköder-Rasseln sind wie Unterwasser-Maranacas. In vielen Wobblern, Jerkbaits, Twitchbaits oder auch speziellen Glasrasseln für Montagen befinden sich Kammern mit kleinen Kugelnpetri-heil.ch. Beim Zug durch das Wasser oder bei Bewegung prallen diese Kugeln gegeneinander und gegen die Kammerwände. Das ergibt das charakteristische “Klickern und Klackern” – mal als dumpfes Tock-Tock, mal als feines Rasselgeräusch, je nach Konstruktion. Material und Größe der Kugeln bestimmen die Tonhöhe maßgeblich. Harte Materialien wie Stahl erzeugen helle, hochfrequente Töne, während weichere oder schwerere Materialien (z.B. Bleikugeln) eher dumpfe, tieffrequente Klänge hervorbringen. Auch die Anzahl und Größe der Kugeln ist entscheidend: Viele kleine Stahlkügelchen = lautes, hohes Rasseln; wenige große Kugeln = lauteres Knocken mit tieferer Tonlage.
Einige Köderhersteller geben sich Mühe und tüfteln wirklich an diesen Details, um ein „passendes“ Geräusch zu erzeugen, das einerseits Fische reizen soll, andererseits aber den Köder nicht aus der Balance bringt. Die meisten Herstellern wird allerdins wenig Wert auf die Kugel gelegt.
Viele kleine Kugeln aus Stahl → helles, hochfrequentes Rasseln.
Wenige große Kugeln → dumpfes „Knocken“ mit tieferen Frequenzen.
Glas- oder Plastikkugeln → leiseres, höheres Klicken.
Aber: Jeder Köder, ob mit oder ohne Rassel, erzeugt beim Lauf Druckwellen. Diese Vibrationen bewegen sich im tieffrequenten Bereich, also genau dort, wo Fische hören oder mit der Seitenlinie spüren können. Das eigentliche Anlocken geschieht daher nicht über das hochfrequente Rasseln, sondern über die tiefen Drucksignale des gesamten Köders.
Studienlage: Was die Forschung zeigt
Ein Schlüssel-Experiment führten Dr. Hongyan (Hong) Yan und Benjamin D. Messer 2017/2018 in Kentucky durch: Sie haben 23 verschiedene Rassel-Köder (v.a. Bass-Crankbaits und Wobbler) in einem Testbecken akustisch vermessen. Jeder Köder wurde im Wasser an einem Hydrofon vorbeigezogen, und ein Computer ermittelte den dominanten Frequenzbereich jedes Rassel-Geräusche.
Das dominante Frequenzband ist dabei der lauteste Ton bzw. der Frequenzbereich mit der höchsten Energie des Geräuschs. Das Ergebnis war verblüffend (und für Rassel-Fans etwas enttäuschend): Nur wenige Köder erzeugten dominierende Geräusche innerhalb des für Fische hörbaren Bereichs. Konkret lagen bei 20 von 23 Kunstködern die Hauptfrequenzen zwischen ~3200 Hz und 9990 Hz – weit oberhalb dessen, was ein Schwarzbarsch, Zander oder Hecht überhaupt wahrnehmen kann.
Nur 3 Köder im Test hatten eine dominante Frequenz unterhalb von 1000 Hz, also im “Sweet Spot” der Bass-Hörkurve Ähnlich stellte es ein Bericht der International Game Fish Association fest: “Die lautesten Geräusche von Rassel-Wobblern sind hochfrequent – meist über 2 kHz – und damit jenseits der Hörreichweite der meisten Sportfische”. Mit anderen Worten: Das grelle Geklapper, das wir beim Schütteln eines Wobblers hören, bleibt für einen Hecht vermutlich stumme Kulisse.
Forscher wie Popper und Ladich haben zudem gezeigt:
Die meisten Süßwasserfische hören nur bis etwa 1.000 Hz.
Hörspezialisten wie Karpfen oder Wels nehmen auch leisere Geräusche wahr, sind aber ebenfalls nicht für hohe Frequenzen ausgelegt.
Tiefe Töne und Druckschwankungen sind die entscheidenden Reize.
Das bestätigt unsere Vermutung: Nicht das Rasseln an sich, sondern die Bewegung des Köders locken Fische an.
Praxis und Köderindustrie: Marketing vs. Realität
Hier stellt sich die kritische Frage: Warum werden so viele Köder mit Rasseln ausgestattet, wenn der Effekt fraglich ist?
Ein Grund liegt in uns Anglern selbst. Wir hören das Rasseln, wir spüren, dass der Köder „arbeitet“, und wir glauben, damit einen Vorteil zu haben.
Es ist mit uns Anglern fast so wie bei kleinen Kindern im Spielzeugladen. Alles was bunt ist und Lärm macht, finden wir Angler anscheinend irgendwie toll.
Für viele Hersteller reicht das – der Köder verkauft sich besser, weil er „laut“ klingt.
Realistisch betrachtet:
Viele Rasseln erzeugen Frequenzen, die unsere Zielfische kaum wahrnehmen.
Der Mehrwert liegt oft mehr in der Wahrnehmung des Anglers als im tatsächlichen Fangerfolg.
Köder mit durchdachten, tieffrequenten Rasseln oder mit verstärkten Drucksignalen sind selten – aber hier steckt echte Entwicklungsarbeit.
Ein Blick auf die Kosten verdeutlicht das: Wer aktiv spinnt, gibt im Jahr leicht mehrere hundert Euro für neue Köder aus. Rasselköder liegen oft im oberen Preissegment. Die entscheidende Frage lautet: Zahlen wir für echte Innovation – oder lassen wir uns manchmal von Marketing und Klang beeindrucken?
Natürlich gibt es Hersteller, die sich intensiv mit Akustik beschäftigen und versuchen, gezielt Frequenzen im Hörbereich der Fische zu nutzen. Andere bauen schlicht eine Rassel ein, ohne Rücksicht darauf, ob der erzeugte Ton im Wasser überhaupt relevant ist.
Fazit
Zum Abschluss die wichtigsten Punkte nochmals motivierend zusammengefasst:
Unsere heimischen Fische hören überwiegend tiefe Frequenzen. Hecht, Barsch & Co sind auf Bass-Töne geeicht (meist unter ~500 Hz), während Karpfen und Wels als Hörspezialisten ein etwas breiteres Spektrum bis ~1000 Hz (und etwas darüber) abdecken. Ultraschall oder sehr hohe Geräusche (>2 kHz) bleiben für die meisten Süßwasserfische unhörbar.
Rasselnde Köder klingen für uns oft “lauter” als für Fische. Die dominierenden Klack-Töne liegen meist in einem Bereich, den z.B. ein Zander kaum wahrnimmt. Doch solche Köder erzeugen trotzdem unterstützende Vibrationen und tiefe Nebengeräusche, die Fische bemerken können – vor allem im Nahbereich und über die Seitenlinie. Unterschätzt also nicht die Wirkung jedes Köders, auch ohne Rassel.
Hast du noch Zeit für eine kurze Bewertung?
Würde uns echt freuen. Nur so werden wir besser.
Durchschnittliche Wertung 4.4 / 5. Anzahl Bewertungen: 43
Sei der Erste, der diesen Beitrag bewertet!